- Jura Intensiv
- RA - Ausbildungszeitschrift
- RA Digital
RA Digital - 11/2022
- Text
- Verlagjuraintensivde
- Entscheidung
- Zivilrecht
- Anspruch
- Recht
- Urteil
- Verlags
- Inhaltsverzeichnis
- Stgb
- Jura
- Intensiv
594 Öffentliches Recht
594 Öffentliches Recht RA 11/2022 Problem: Verfassungsmäßigkeit des sog. Kreuzerlasses Einordnung: Grundrechte VGH München, Urteil vom 01.06.2022 5 B 22.674 LEITSÄTZE 1. Das Kreuz ist ein Symbol christlicher Religion und kann nicht isoliert nur als Symbol der geschichtlichen und kulturellen Prägung verstanden werden. 2. Die Pflicht des Staates zu weltanschaulich-religiöser Neutralität als objektiv-rechtliches Verfassungsprinzip begründet als solches keine einklagbaren subjektiven Rechte von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Diese können einen Abwehranspruch nur dann geltend machen, wenn eines der Grundrechte verletzt wird, aus denen die staatliche Neutralitätspflicht hergeleitet wird (Art. 4 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG). 3. Ein Verstoß gegen das Gebot staatlicher Neutralität, der sich in einer bloß passiven Verwendung eines religiösen Symbols ohne missionierende oder indoktrinierende Wirkung erschöpft und mit keinen weiteren Nachteilen für andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften verbunden ist, verletzt weder deren Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit noch auf Gleichbehandlung. Obersatz FBA Voraussetzungen des FBA EINLEITUNG Gegenstand des Urteils ist der sog. Kreuzerlass der Bayerischen Staatsregierung aus dem Jahr 2018, der damals für großes Aufsehen gesorgt und eine neuerliche „Kreuz-Debatte“ ausgelöst hat. SACHVERHALT Die Kläger sind Weltanschauungsgemeinschaften und als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt. Sie wenden sich gegen die Umsetzung des sog. Kreuzerlasses der Bayerischen Staatsregierung. Diese hatte beschlossen, in § 28 der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats Bayern (AGO) folgende Regelung einzufügen: „Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“ Die Kläger verlangen, die in den Dienstgebäuden angebrachten Kreuze wieder zu entfernen, weil ein Verstoß gegen die Pflicht des Staates zu weltanschaulich-religiöser Neutralität und gegen Art. 3 III 1, 4 I, II GG vorliege. Die Existenz und das Wissen der Öffentlichkeit von der Anbringung der Kreuze bevorzuge die christlichen Religionsgemeinschaften und erwecke den Anschein der Parteilichkeit des Staates. Dieser Argumentation tritt die Bayerische Staatsregierung mit dem Hinweis entgegen, dass die Kreuze in den Behörden nicht als religiöse Symbole Verwendung fänden, sondern Ausdruck eines Bekenntnisses zur christlich-abendländischen Tradition seien. Ferner lasse sich die objektiv-rechtliche staatliche Neutralitätspflicht nicht generell einfordern, sondern verlange eine subjektiv-rechtliche Betroffenheit der Kläger, an der es aber fehle. Haben die Kläger einen Anspruch auf Entfernung der Kreuze? Jura Intensiv LÖSUNG Die Kläger haben einen Anspruch auf Entfernung der Kreuze, wenn für dieses Begehren eine Anspruchsgrundlage besteht, deren Voraussetzungen vorliegen. I. Anspruchsgrundlage Als Anspruchsgrundlage kommt der gewohnheitsrechtlich anerkannte Folgenbeseitigungsanspruch (FBA) in Betracht. II. Anspruchsvoraussetzungen Der FBA verlangt tatbestandlich einen hoheitlichen Eingriff in ein subjektivöffentliches Recht, der zu einem rechtswidrigen Zustand im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung führt. Hier kommt einerseits eine Verletzung der weltanschaulich-religiösen Neutralitätspflicht des Staates und andererseits ein Verstoß gegen Art. 3 III 1, 4 I, II GG in Betracht. 1. Weltanschaulich-religiöse Neutralitätspflicht des Staates „[…] der Staat [ist] als Heimstatt aller Staatsbürger durch Art. 4 Abs. 1, Art. 3 Abs. 3 Satz 1, Art. 33 Abs. 3 GG sowie durch Art. 136 Abs. 1 und 4 und Inhaltsverzeichnis © Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
RA 11/2022 Öffentliches Recht 595 Art. 137 Abs. 1 WRV in Verbindung mit Art. 140 GG zu weltanschaulichreligiöser Neutralität und einer am Gleichheitssatz orientierten Behandlung der verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften verpflichtet; er darf sich nicht mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft identifizieren. Der freiheitliche Staat des Grundgesetzes ist gekennzeichnet von Offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschaulich-religiöser Überzeugungen und gründet dies auf ein Menschenbild, das von der Würde des Menschen und der freien Entfaltung der Persönlichkeit in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung geprägt ist. […] das Kreuz [ist] Symbol einer bestimmten religiösen Überzeugung und nicht etwa nur Ausdruck der vom Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur […]. Es wäre eine dem Selbstverständnis des Christentums und der christlichen Kirchen zuwiderlaufende Profanisierung des Kreuzes, wenn man es als bloßen Ausdruck abendländischer Tradition oder als kultisches Zeichen ohne spezifischen Glaubensbezug ansehen wollte. […] Durch die Anbringung der Kreuze in den Eingangsbereichen der staatlichen Dienstgebäude wird das Symbol des christlichen Glaubens in einem öffentlich zugänglichen staatlichen Raum präsentiert. Die Symbole anderer Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften werden nicht in gleicher Weise ausgestellt. Hierin liegt eine sachlich nicht begründete Bevorzugung des christlichen Symbols […]. Der Beklagte meint zwar sinngemäß, in § 28 AGO werde klargestellt, dass die in den Dienstgebäuden anzubringenden Kreuze als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns zu verstehen seien. Subjektiv beabsichtigt er demnach offenbar keine Identifikation mit dem christlichen Symbol. Dies ändert aber nichts an der rechtlichen Bewertung bezogen auf das Neutralitätsgebot, zumal dem Kreuz wie beschrieben ein anderer objektiver Sinngehalt zukommt. Zum einen kann der Beklagte insoweit keine Deutungshoheit beanspruchen; die Symbolkraft eines Wandkreuzes in der Gesellschaft kann nicht auf eine solche profane Bedeutung reduziert werden […]. Zum anderen kann das Kreuz in einem Dienstgebäude nach dem maßgeblichen Empfängerhorizont eines Besuchers im Sinne einer Nähe zum Christentum interpretiert werden. […] Jura Intensiv Auch gibt es in staatlichen Dienstgebäuden keinerlei Bezug zu religiösen Inhalten. Es handelt sich beim Eingangsbereich staatlicher Dienststellen um einen rein weltlichen Lebensbereich. Die christlich und humanistisch geprägte abendländische Tradition des Freistaats Bayern stellt keinen ausreichenden Grund dar, das Kreuz als das Symbol des christlichen Glaubens schlechthin im Eingangsbereich sämtlicher staatlicher Dienststellen, d.h. in Behörden, die mit reinen Verwaltungsaufgaben oder technischen Aufgaben betraut sind, anzubringen. Das christliche Kreuz hat keinen Bezug zu diesen Örtlichkeiten. Etwas Anderes kann dann gelten, wenn das Kreuz in einem konkreten musealen oder kulturellen Kontext verwendet wird […]. So liegt es aber hier nicht.“ Demnach verstößt die Anbringung von gut sichtbaren Kreuzen im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes gegen die weltanschaulichreligiöse Neutralitätspflicht des Staates. Fraglich ist jedoch, ob dieser objektivrechtliche Verstoß zugleich ein subjektives Recht der Kläger begründet. Herleitung und Inhalt der staatlichen Neutralitätspflicht Kreuz ist religiöses (christliches) und nicht nur ein kulturelles Symbol. Ungerechtfertigte Bevorzugung des Christentums Sinngehalt eines Kreuzes ist objektiv zu bestimmen Christlich-abendländische Tradition Bayerns rechtfertigt das Anbringen von Kreuzen nicht. Genau umgekehrte Schlussfolgerung bei Friedrich, NVwZ 2018, 1007, 1011, der keinen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht erkennt. Fazit: Verstoß gegen staatliche Neutralitätspflicht (+) Aber: Leitet sich aus Verstoß auch ein subjektives Recht ab? © Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG Inhaltsverzeichnis
- Seite 1 und 2: WISSEN was geprüft wird Für Studi
- Seite 3 und 4: RA 11/2022 Editorial EDITORIAL Geor
- Seite 5 und 6: RA 11/2022 ZIVILRECHT Zivilrecht 56
- Seite 7 und 8: RA 11/2022 Zivilrecht 563 gleichwoh
- Seite 9 und 10: RA 11/2022 Zivilrecht 565 Problem:
- Seite 11 und 12: RA 11/2022 Zivilrecht 567 Hier hatt
- Seite 13 und 14: RA 11/2022 Zivilrecht 569 [10] Grun
- Seite 15 und 16: RA 11/2022 Zivilrecht 571 Problem:
- Seite 17 und 18: RA 11/2022 Zivilrecht 573 B. Begrü
- Seite 19 und 20: RA 11/2022 Zivilrecht 575 Sie sind
- Seite 21 und 22: RA 11/2022 Referendarteil: Zivilrec
- Seite 23 und 24: RA 11/2022 Referendarteil: Zivilrec
- Seite 25 und 26: RA 11/2022 Referendarteil: Zivilrec
- Seite 27 und 28: RA 11/2022 Referendarteil: Zivilrec
- Seite 29 und 30: RA 11/2022 NEBENGEBIETE Nebengebiet
- Seite 31 und 32: RA 11/2022 Nebengebiete 587 2.3.2.
- Seite 33 und 34: Ihre neuen Begleiter für die Exame
- Seite 35 und 36: Die BASIS-FÄLLE Inkl. Zugangscode
- Seite 37 und 38: RA 11/2022 ÖFFENTLICHES RECHT Öff
- Seite 39 und 40: RA 11/2022 Öffentliches Recht 591
- Seite 41: RA 11/2022 Öffentliches Recht 593
- Seite 45 und 46: RA 11/2022 Öffentliches Recht 597
- Seite 47 und 48: RA 11/2022 Referendarteil: Öffentl
- Seite 49 und 50: RA 11/2022 Referendarteil: Öffentl
- Seite 51 und 52: RA 11/2022 Referendarteil: Öffentl
- Seite 53 und 54: RA 11/2022 STRAFRECHT Strafrecht 60
- Seite 55 und 56: RA 11/2022 Strafrecht 607 II. Unmit
- Seite 57 und 58: RA 11/2022 Strafrecht 609 Problem:
- Seite 59 und 60: RA 11/2022 Strafrecht 611 ist objek
- Seite 61 und 62: RA 11/2022 Referendarteil: Strafrec
- Seite 63 und 64: RA 11/2022 Referendarteil: Strafrec
- Seite 65 und 66: Definitionen und Kernprobleme auf e
- Seite 67 und 68: Bestens ausgestattet mit Jura Inten
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...





































































































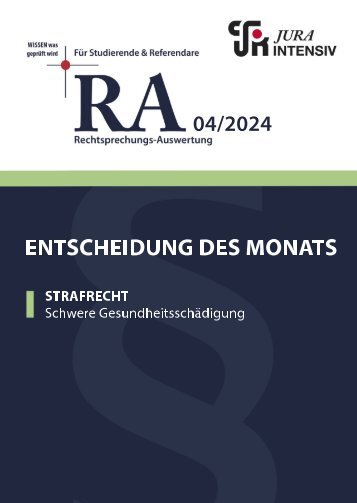
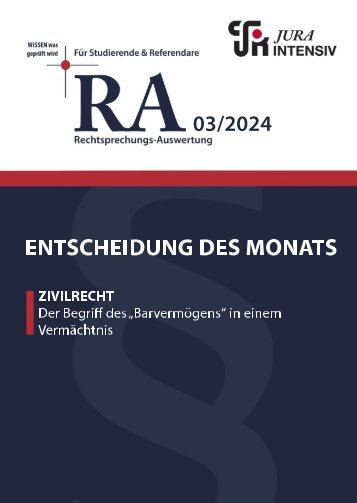
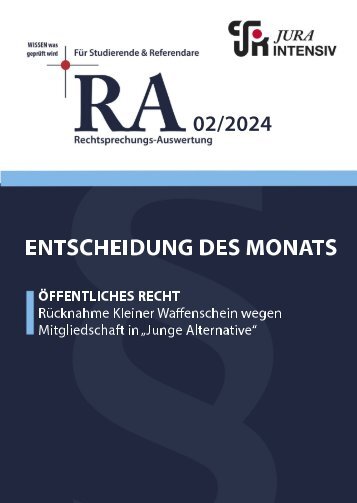
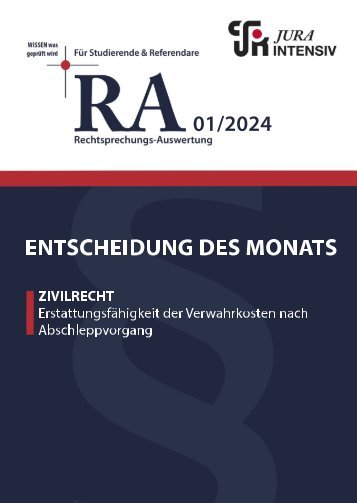
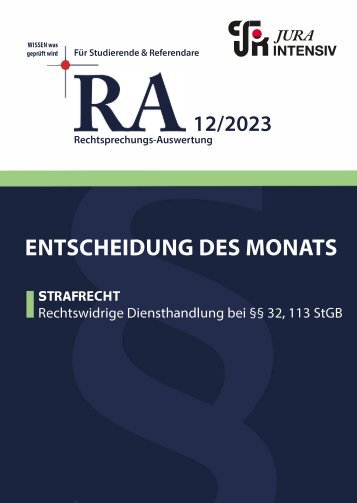
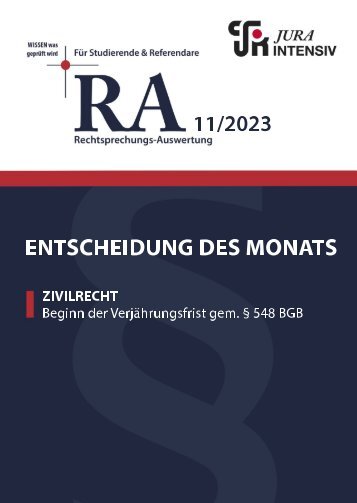
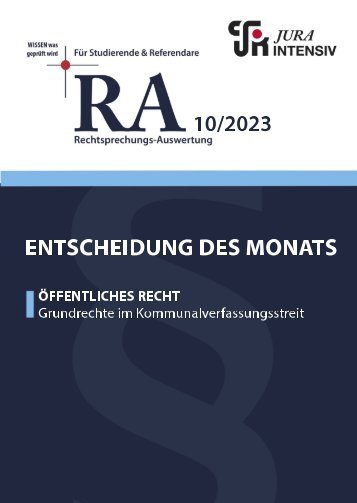
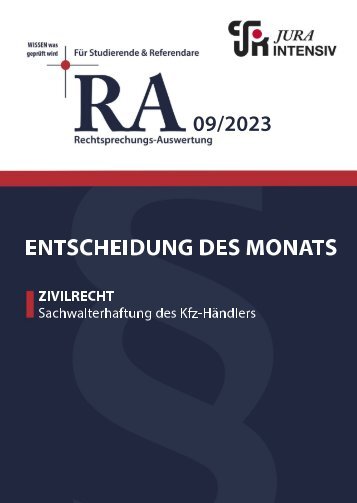
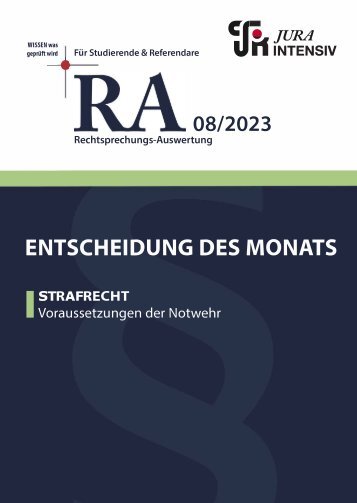
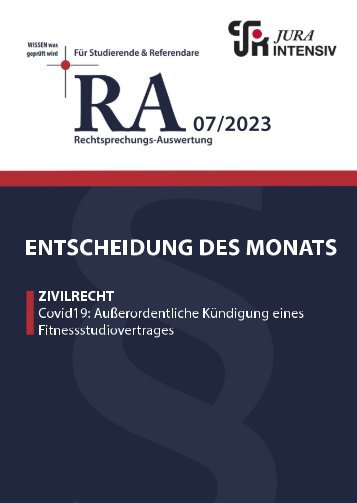
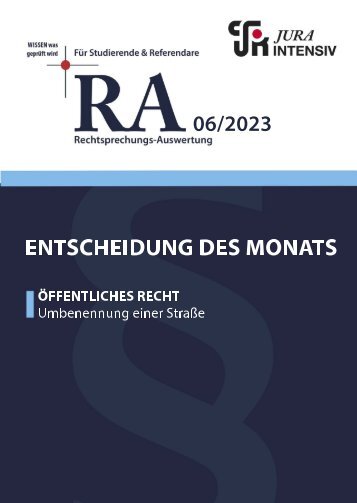
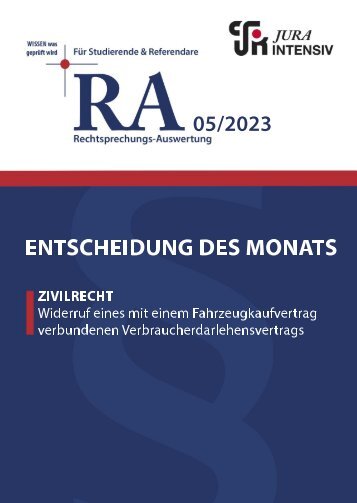
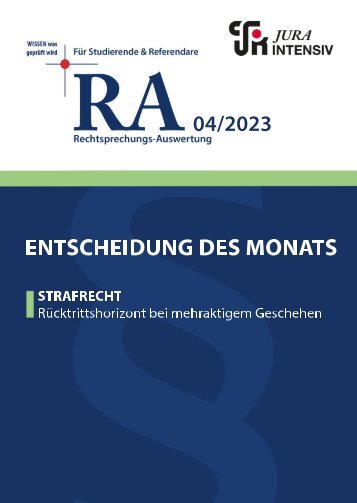
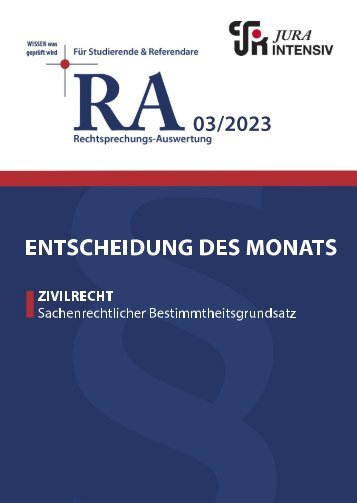
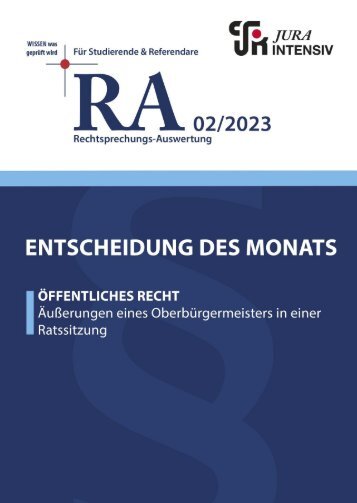
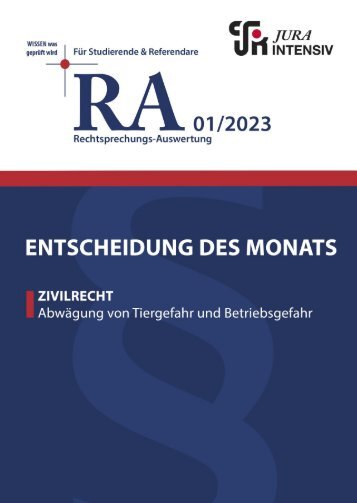
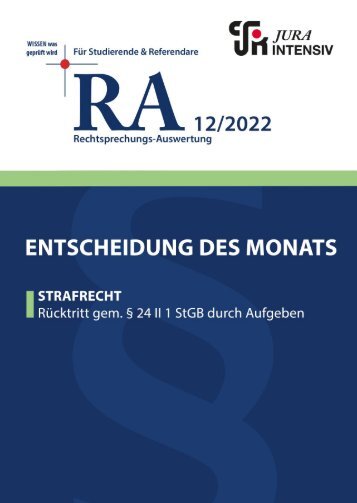
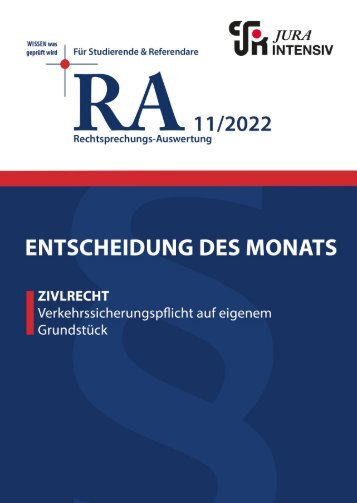
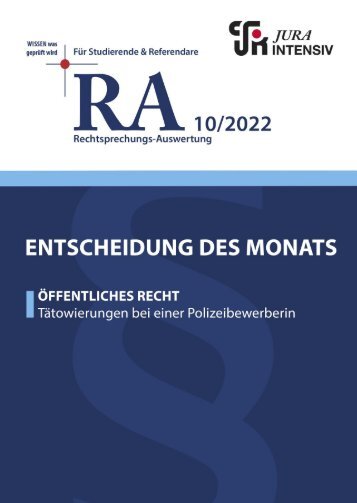
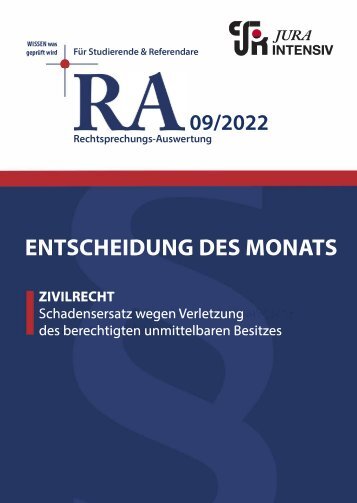
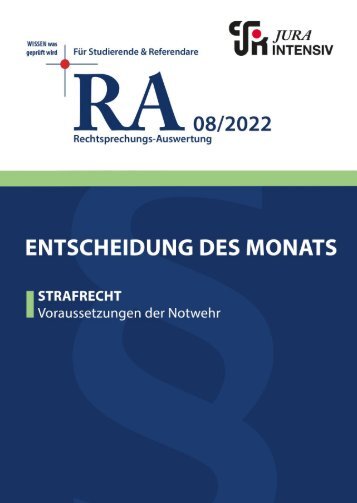
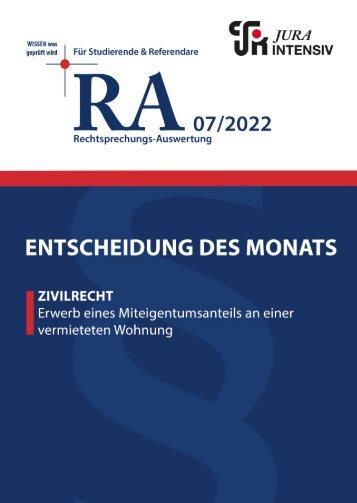
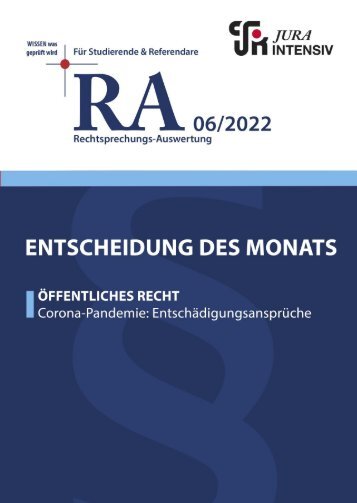
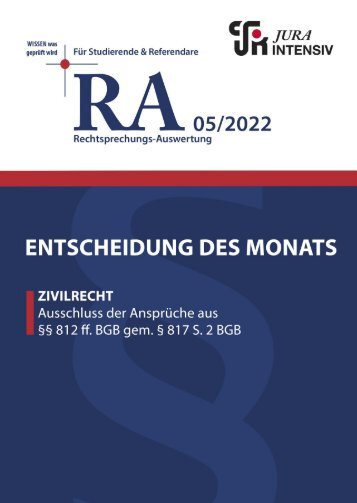
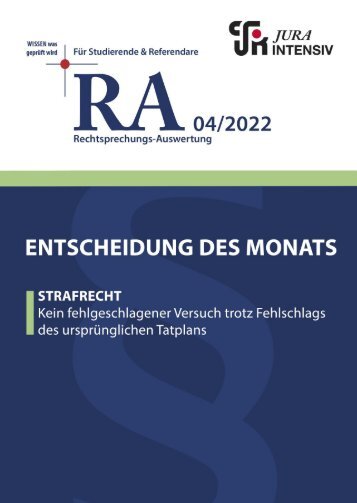
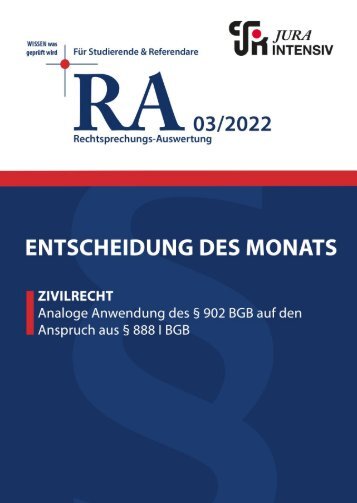
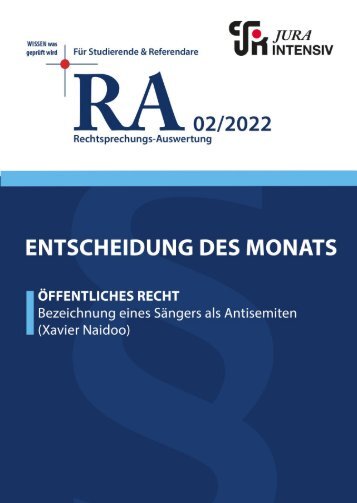
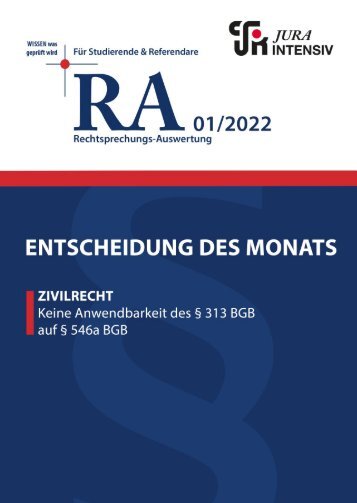
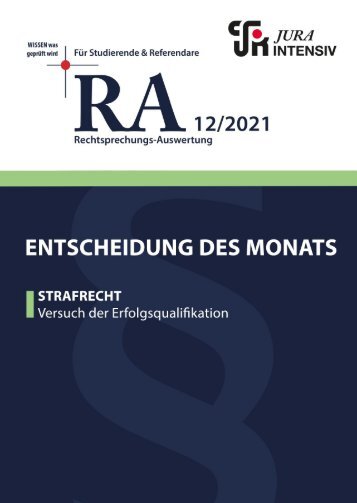
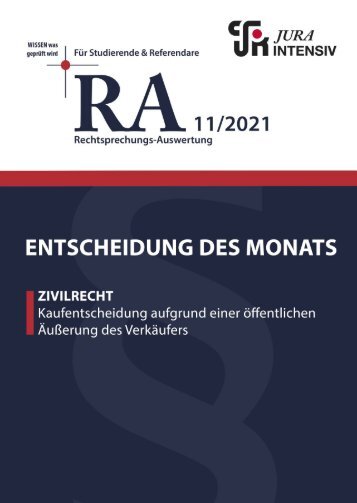
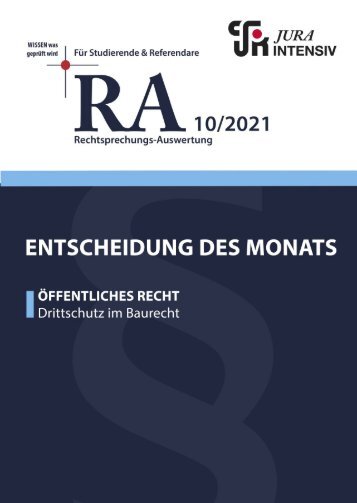
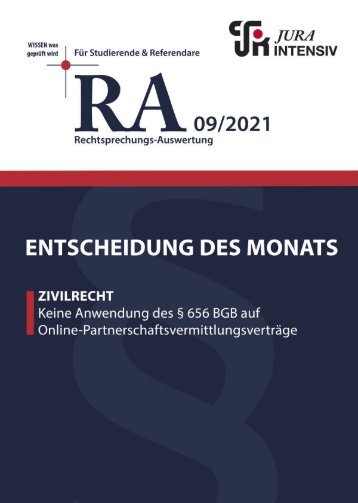
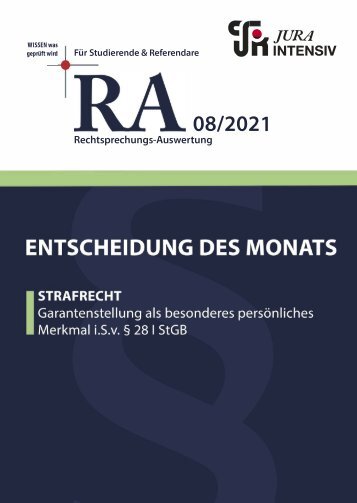
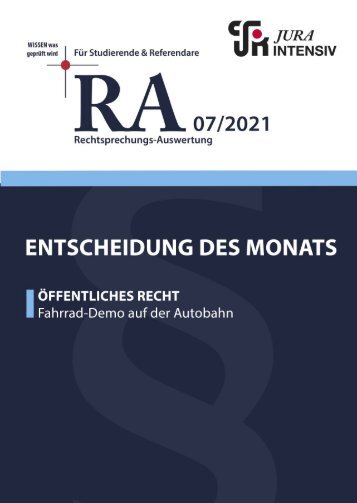
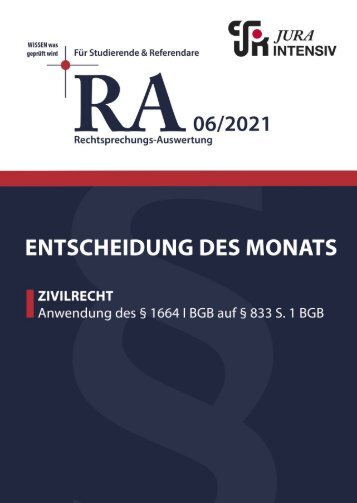
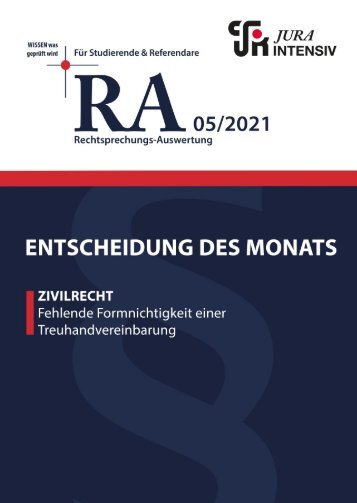
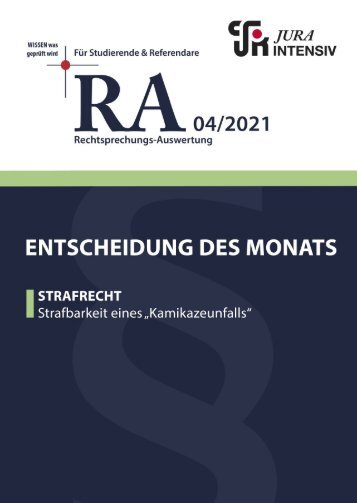
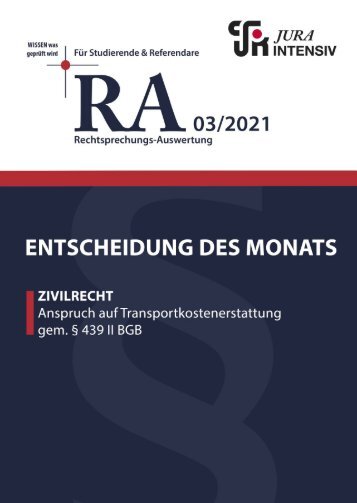
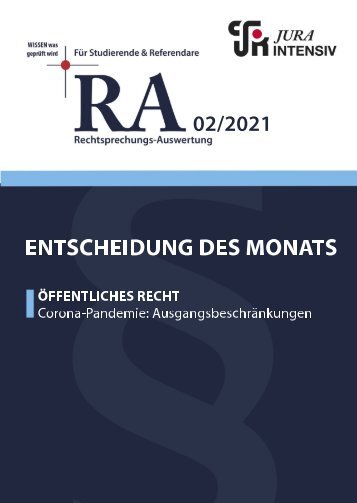
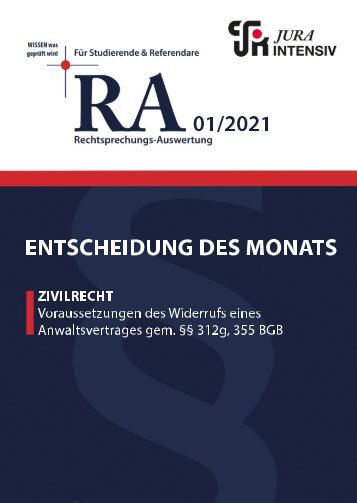
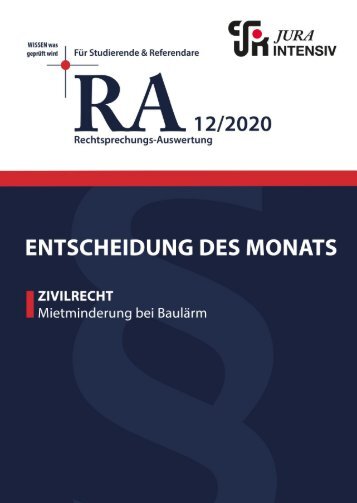
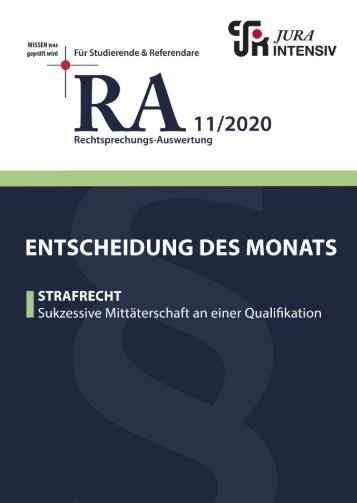
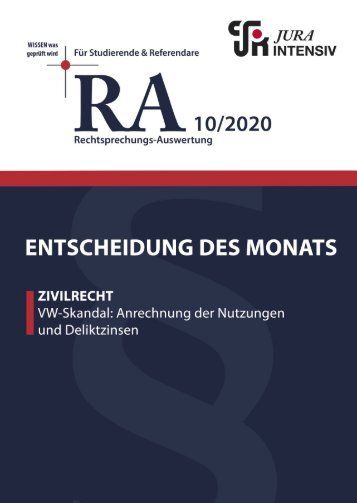
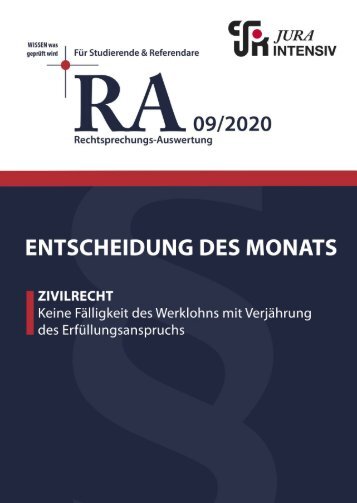
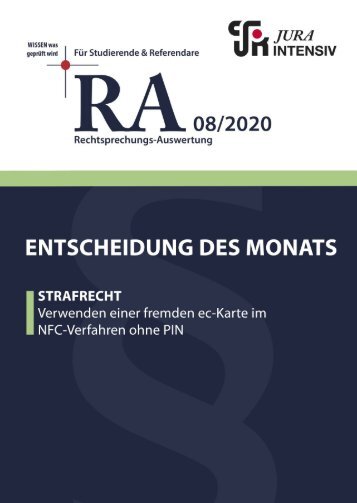
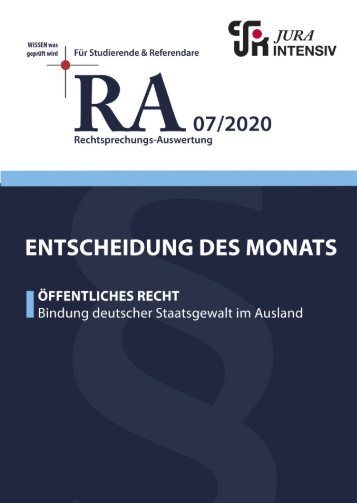
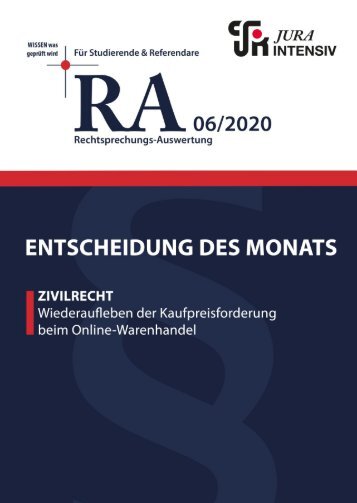
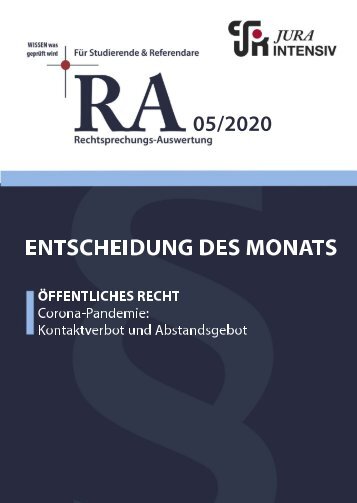
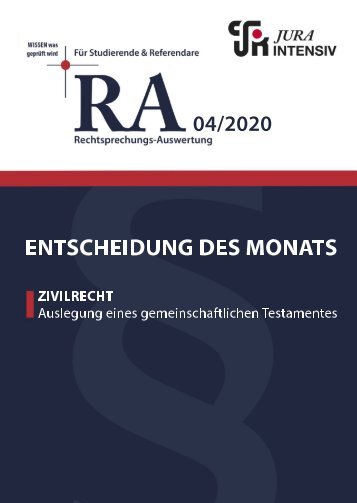
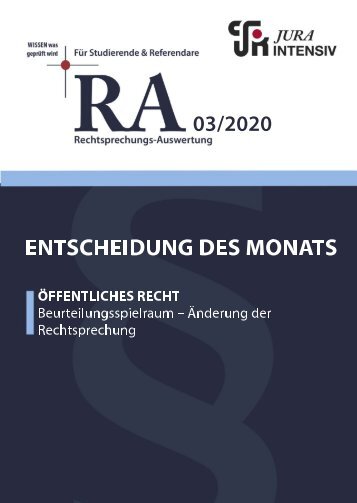

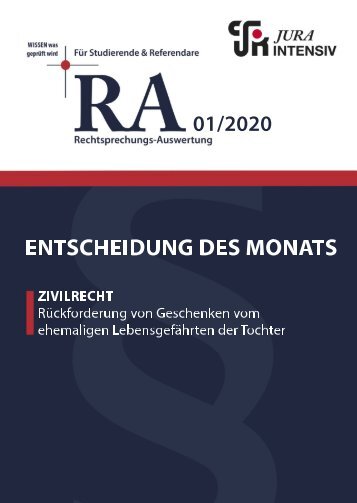
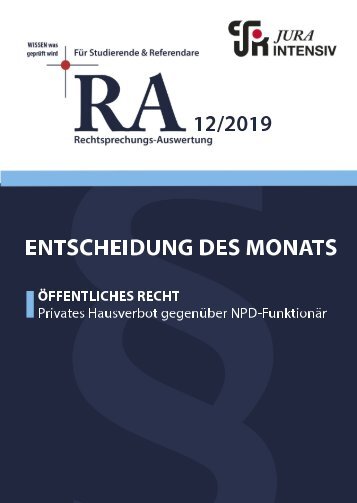
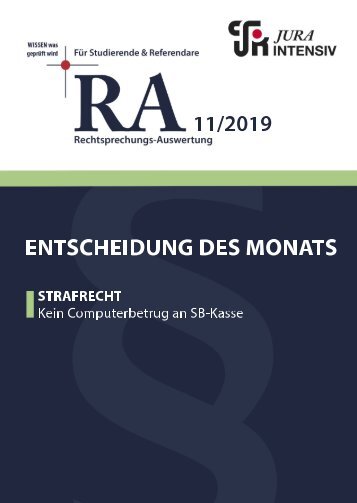
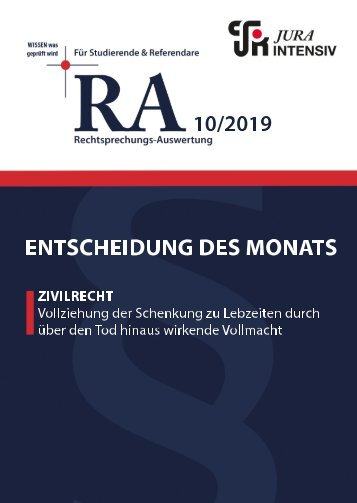
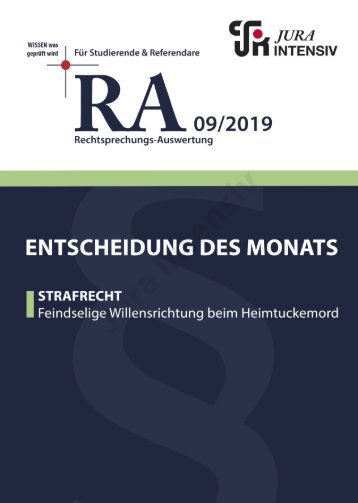
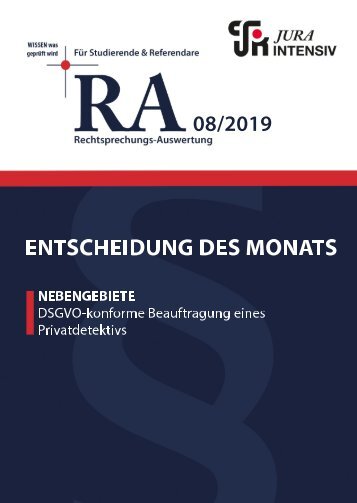
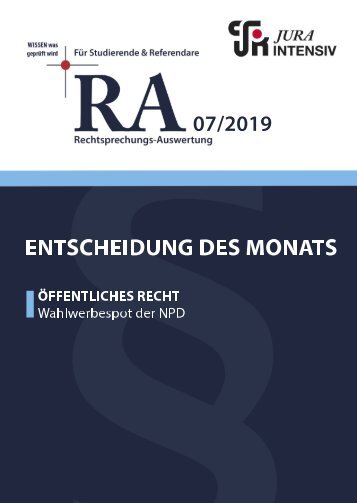
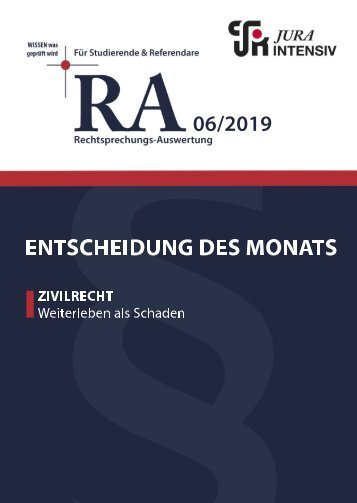
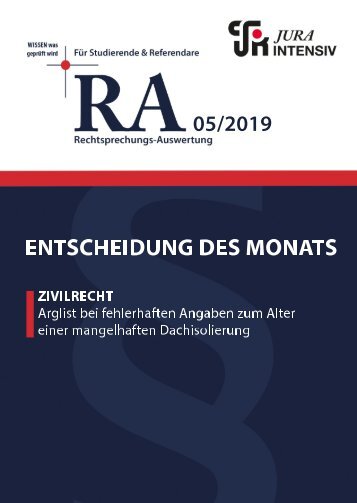
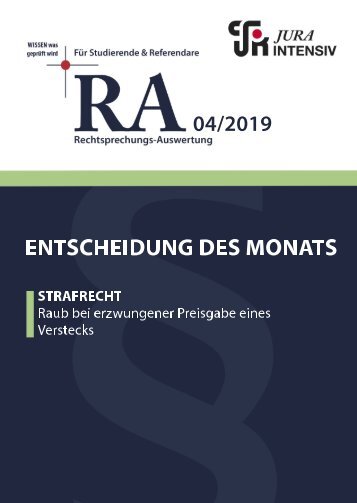
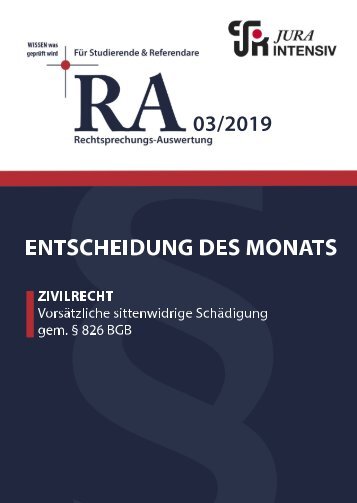
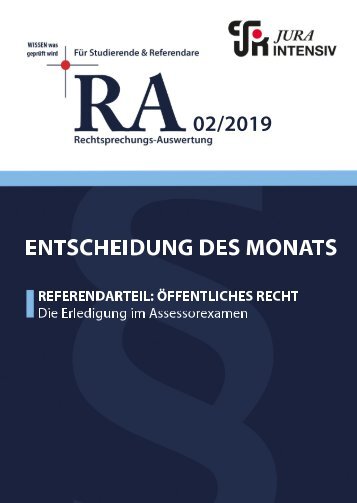
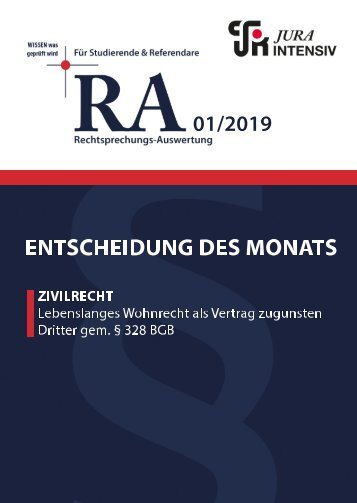
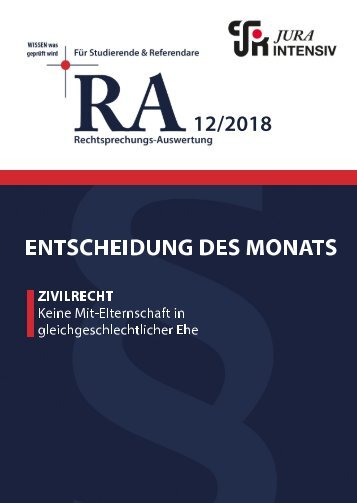
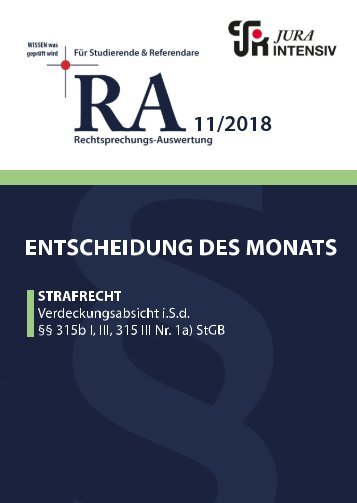
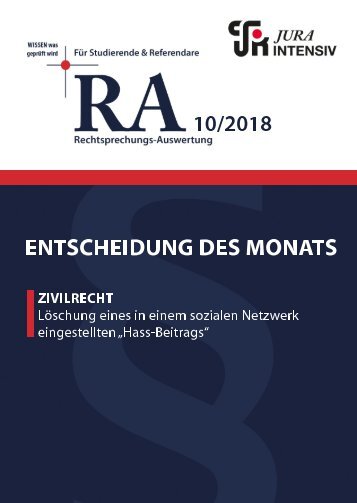
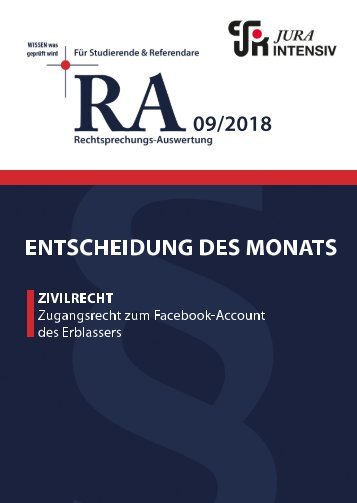
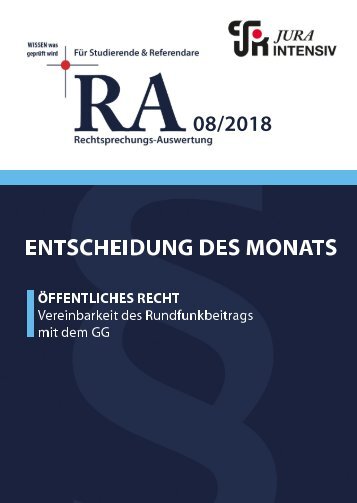
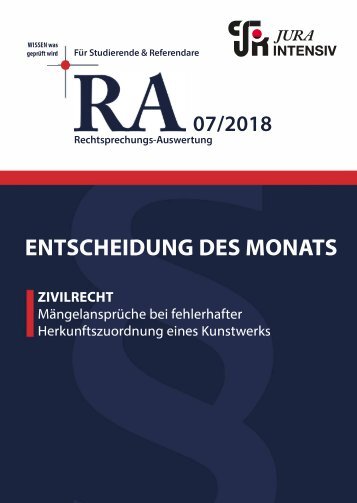
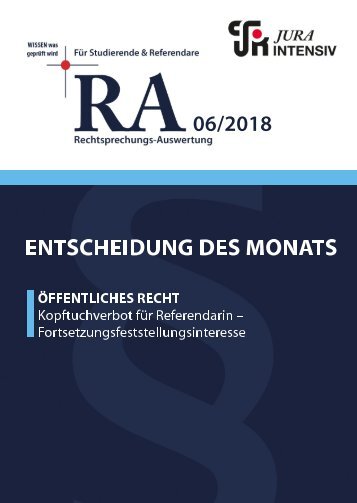
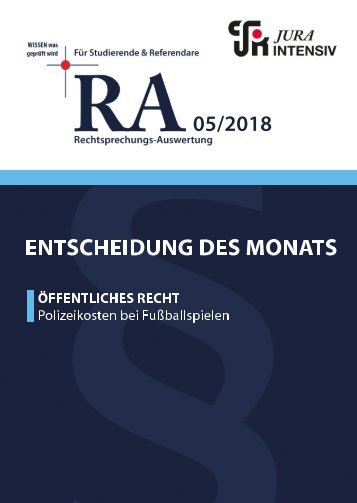
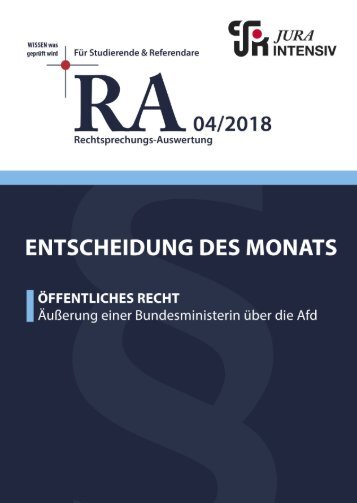
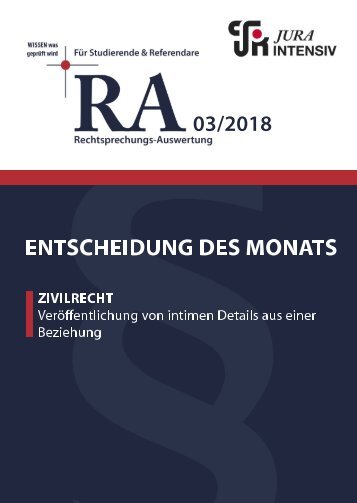
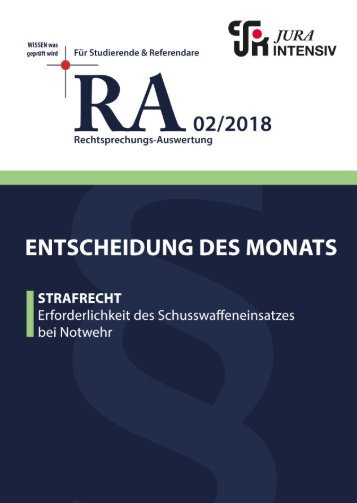
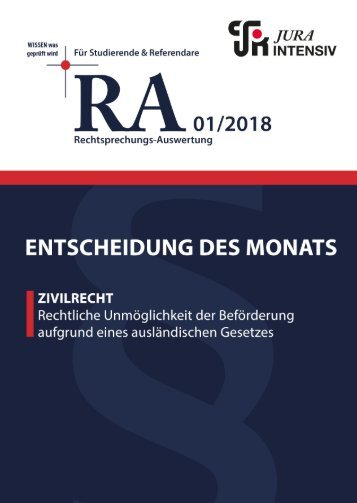
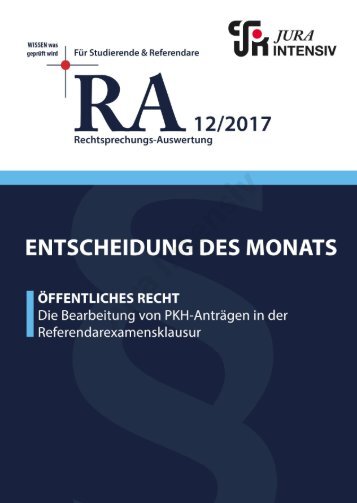

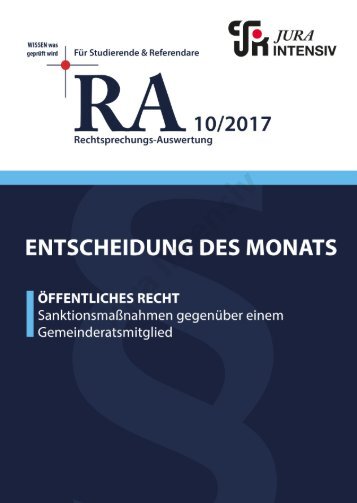


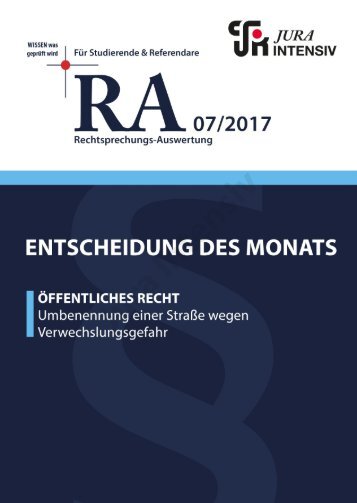
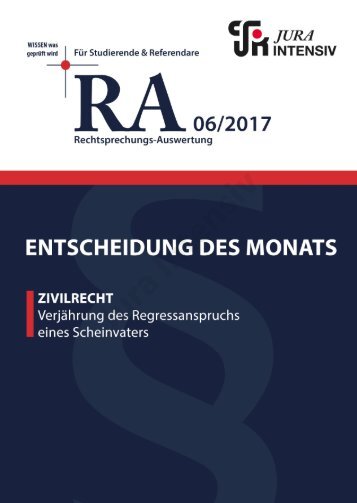
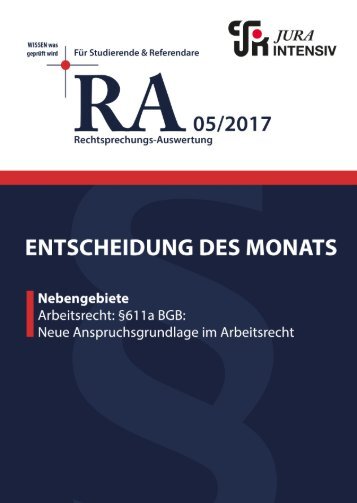
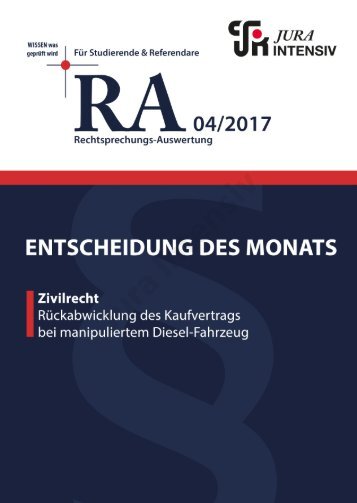

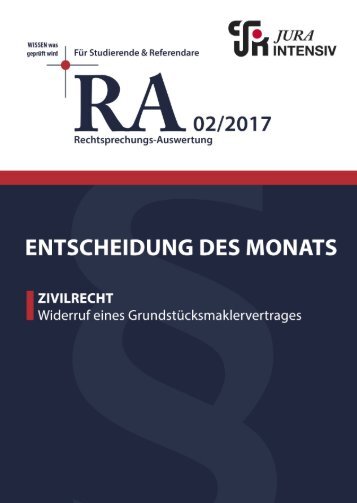
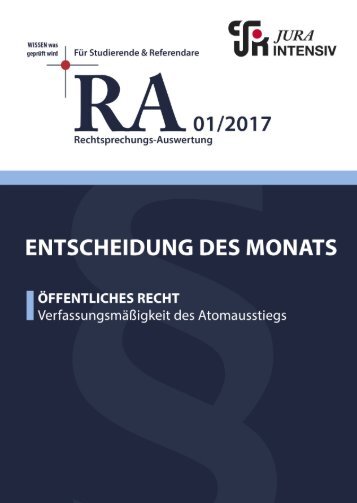
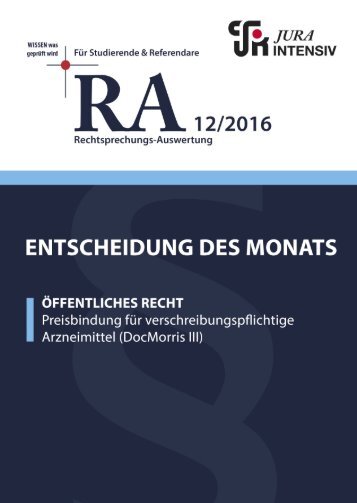
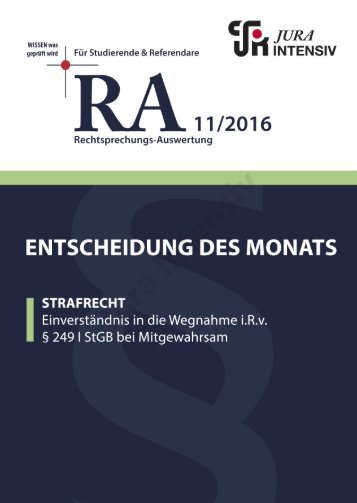
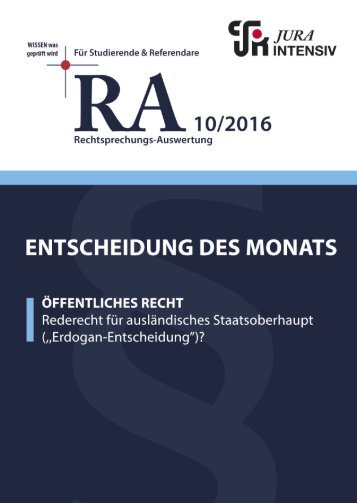
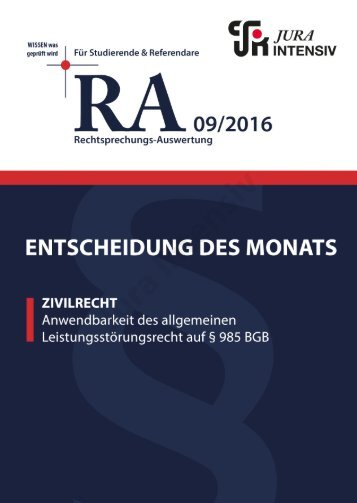
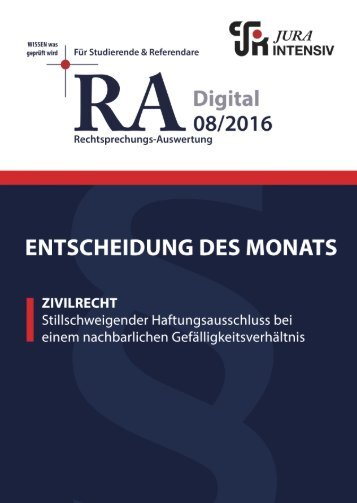
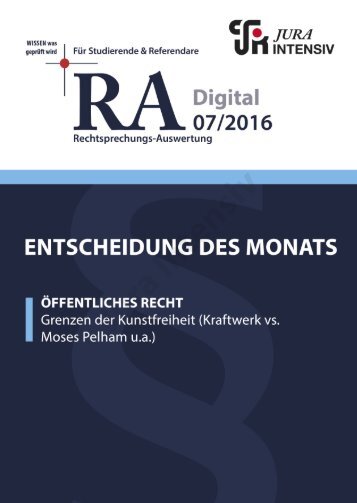
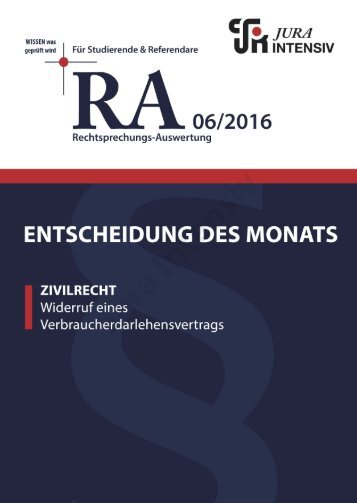
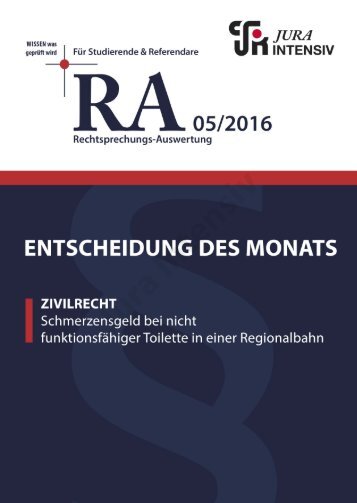
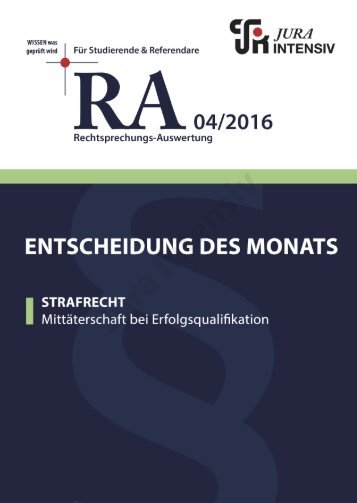
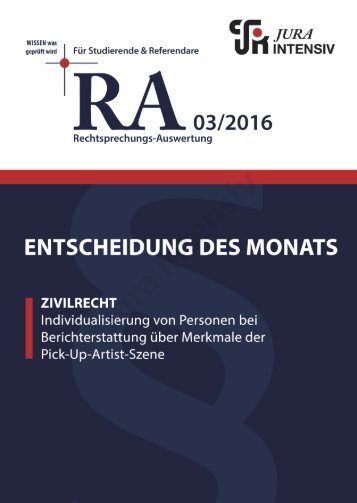
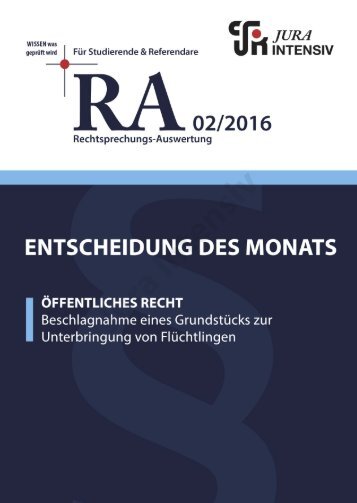
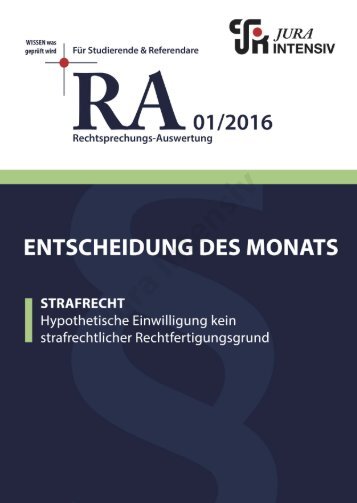
Follow Us
Facebook
Twitter